Die Mahnwache für Kunst und Kultur am Potsdamer Platz in Berlin ist innerhalb weniger Monate zu einer Institution geworden. Jeden Mittwoch treffen sich hier Kulturschaffende, um an die Nöte ihrer Zunft zu erinnern, politische Forderungen zu stellen, aber auch um ihre Kunst vorzutragen. Das sind Bedingungen, unter denen sich die Berliner Schriftstellerin Jeannette Abée wohlfühlt. Vor der Corona-Krise traf sie häufig auf Kultur- und Stadtfestivals auf oder trug ihre Texte auf Lesungen und im Rahmen diverser Ausstellungen vor.
Seitdem das Kulturleben wegen der harten Maßnahmen stillsteht, ist die Mahnwache eine der ganz wenigen Möglichkeiten, mit dem Publikum zu interagieren. Dabei ist es gerade der Klang der Sprache, der Abées Literatur ausmacht. „Der Rhythmus muss stimmen“, sagt sie, weshalb sie ihre Texte so lange schleift, bis sie das Ohr beglücken. Ihr Metier sind die kurzen Formen: Gedichte, lyrische Prosa, Dialoge, kleine Szenen, Aphorismen, prägnante Tagebucheinträge. Publiziert werden sie unter anderem auf ihrer Homepage. Einige Werke erscheinen in der Zeitschrift Prolog oder in kleinen Editionen, die Abée verschenkt. Leben kann sie von ihrer Literatur nicht. Doch sie findet in ihr ihre Erfüllung.
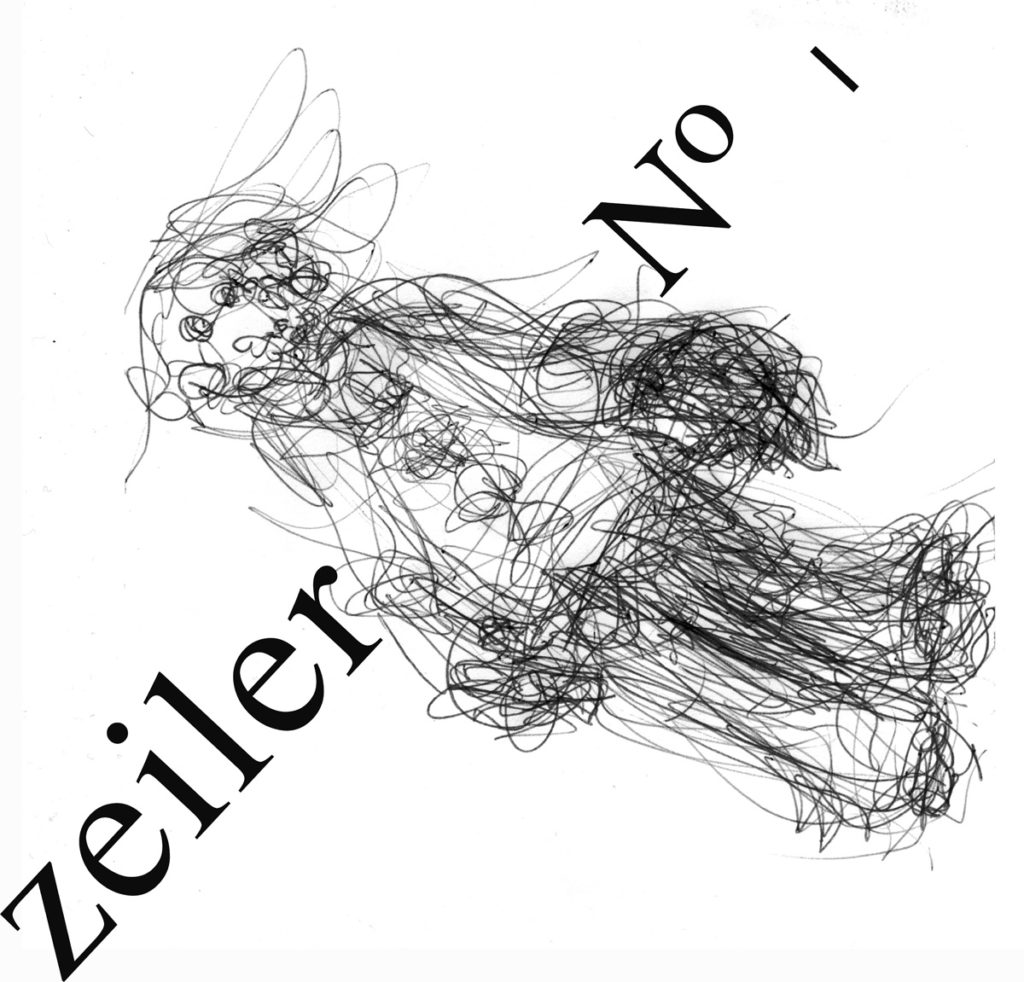
Das Schreiben ist Abée ein großes Bedürfnis. Damit verbindet sich das Anliegen einer ernsthaften Auseinandersetzung. Es vergeht so gut wie kein Tag, an dem sie nicht zur Feder greift. Das tat sie bereits als Kind, studierte später aber Fotodesign. Bis heute spielen diese beiden Kunstformen eine wesentliche Rolle für ihre kreative Arbeit. Sie fotografiert leidenschaftlich und formuliert poetische Sätze, wobei ihre Texte immer im Zusammenhang mit Bildern entstehen. „Das Bildnerische und das Schreiben befruchten sich gegenseitig“, sagt sie. Das merkt man ihrer Literatur an. Wer Jeannette Abées Werke liest, stellt schnell fest, dass sie auf Beobachtungen beruhen. Beschrieben werden vermeintlich nichtige Alltagszenen oder Naturereignisse, die dann überraschenderweise den einen oder anderen Geistesblitz zeitigen oder einen philosophischen Gedanken in Gang setzen.
Tagebuchprojekt
„Über Nacht hatte der Wind gedreht“, heißt es etwa in einem Eintrag des Tagebuch-Notizen-Projekts 444, „und drängte am Morgen durch das Fenster ein Rauschen herein, das Rauschen fahrender Autos, von den Autobahnen, über die Brandmauern und Dächer hinweg als sich verbreitender Luftstrom, der den Raum füllte. Je mehr er den Raum füllte, desto mehr schwoll er an zur Besinnungslosigkeit, Monstrosität, zum Abstraktum, losgelöst von allen Körpern und Gegenständen, losgelöst von den fahrenden Autos.“
Mit dem Projekt begonnen hat Jeannette Abée im Januar dieses Jahres. „Die Betrachtungen richten sich nicht vorrangig auf vermeintlich Bedeutsames. Sie beginnen oftmals in meiner unmittelbaren Umgebung, dem Wohnumfeld, werden fortgeführt bei Begegnungen im Alltag mit anderen Menschen oder bei Gängen durch die Stadt“, schreibt sie in der Einleitung. „Das Projekt läuft zeitgleich zu einer Entwicklung, die ich als bedeutenden gesellschaftlichen Umbruch wahrnehme.“ Deuten möchte sie diesen Umbruch erst einmal nicht – sie will beobachten.
Zusammenhalt in der Kulturbranche
Was sie feststellen kann, sind sowohl negative als auch positive Entwicklungen. Als eher unerfreuliche Begleiterscheinung sieht sie den Trend, dass Kultur immer mehr im digitalen Raum stattfindet. Die für sie enorm wichtige Interaktion mit dem Publikum verliert damit an Bedeutung. Positiv bewertet sie hingegen die vielen neuen Projekte, die im Zuge der Corona-Krise entstanden sind. „Da bildet sich etwas und wächst etwas, von dem wir noch nicht sagen können, was das wird“, sagt sie.
Gerade die Teilnahme an der Mahnwache am Potsdamer Platz zeigt ihr, dass in der Kulturbranche eine gewisse Gemeinschaft entsteht. „Sonst sind Künstler eher auf sich bedacht“, so Abée. Persönliche Begegnungen erführen durch die Bedingungen während der Coronazeit eine besondere Wertschätzung. Über die Mahnwache für Kunst und Kultur hat Jeannette Abée viele Leute kennengelernt. Die Schriftstellerin freut sich jedes Mal, sie wieder zu treffen. „Es ist wie eine Familie“, sagt sie. Die Veranstaltung habe etwas Persönliches – „sie ist analog“.




