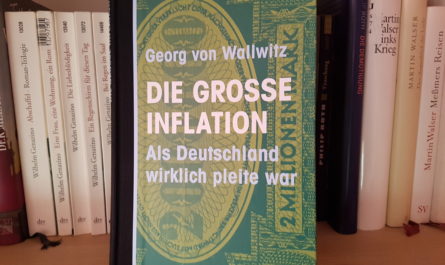Um die Kunstfreiheit ist es schlecht bestellt. Wer sich heute jenseits offizieller Narrative bewegt, bekommt Gegenwind. Diverse sozial-politische Institutionen entscheiden darüber, was gesagt werden darf und was nicht. Selbst Satire muss sich heutzutage zügeln, um ja nicht die Meinungsmacher und Wahrheitswächter zu verärgern. Die sogenannte Cancel Culture schreitet mit Riesenschritten voran und dominiert die künstlerische Produktion. Das macht sie eintönig und fade. Damit sie es nicht wird, müsse Kunst frei und unabhängig sein. So lautet zumindest das Ideal seit dem 19. Jahrhundert, in dem diese Forderung sich Gehör zu verschaffen begann. Doch das Postulat selbst könne den Autonomieerhalt und die Abwehr fremdbestimmter Einflüsse nicht garantieren, schreibt der Intellektuelle Moshe Zuckermann in seinem neuen Buch. Diese Vorstellung sei schlicht naiv.
Der Autor erinnert gleich zu Beginn, dass der Begriff der Kunstautonomie eine gewisse Ambivalenz in sich trage: „Er verweist auf die Selbständigkeit der Kunst im Verhältnis zu dem, was außerhalb ihr liegt, muss aber zugleich in Kauf nehmen, das besagtes ‚außerhalb‘ stets auch ein (aktiver) Bestandteil der Kunst selber ist.“ Kunst bewege sich immer in einem Spannungsfeld. Dieses nachzuzeichnen, ist die Aufgabe, derer sich Zuckermann in «Die Kunst ist frei?» annimmt – in einem Stil, der zwischen Esprit und Ignoranz changiert. Obwohl, wie im Klappentext beschrieben, nicht weniger auf dem Spiel steht als die Rettung der Kunstfreiheit, missachtet Zuckermann die gegenwärtigen Phänomene der Cancel Culture völlig. Zensurmaßnahmen gegen Regimekritiker, wie sie in den sozialen Medien mittlerweile zum Alltag gehören, bleiben genauso unerwähnt wie Diffamierungskampagnen und Kündigungen.
Beispiele aus der Kulturbranche gibt es genug. Kabarettisten verlieren ihre Fernsehsendungen und Auftrittsmöglichkeiten, wenn sie in ihren Gags die EU oder die Corona-Politik kritisieren. Schauspieler müssen sich impfen lassen, wenn sie an den Dreharbeiten teilnehmen möchten. Musiker werden als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt, wenn sie in ihren Songs das aussprechen, was den Raum des Sagbaren überschreitet. Wer das Zeitgeschehen verfolgt, dürfte diese Verzerrungen der Kunstfreiheit mitbekommen. Doch Zuckermann begibt sich lieber in den Elfenbeinturm akademischer Bildung und wirkmächtiger Theorien. In seinem Buch behandelt er das Thema auf essayistische Weise, in Anlehnung an Begriffe und Denkfiguren der Frankfurter Schule und im Kontext der Ideen- und Kulturgeschichte. Er fragt nach dem Verhältnis von Kunst und Fortschritt, seziert ihre Beziehung zu Politik und nimmt Phänomene wie Elitarismus oder kulturindustriellen Kitsch in den Blick.
Von der Kunstimmanenz bis zur Selbstaufhebung
Während Zuckermann den Begriff der Kunstautonomie anfangs noch paradigmatisch erläutert, geht er in der Folge auf die Probleme der Kunstimmanenz ein. Er benennt die sozialen wie kulturellen Elemente, die jenen autonomen Kern bedrohen. Dabei steht die Frage im Raum, wie sich Kunst entwickelt und worin sich ihr Fortschritt erweist. In diesem Zusammenhang geht der Autor ausführlich auf die Innovationskraft der Werke Marcel Duchamps ein, dessen «Fountain» als herausragendes Beispiel dient. Allerdings zeigen sich darin bereits Anzeichen einer Selbstaufhebung der Kunst, die Zuckermann später anhand der sogenannten Konzeptkunst beleuchtet. Schließlich findet eine Auseinandersetzung mit den Kategorien der „hohen“ und „niedrigen“ Kultur statt. Zwischendurch unternimmt der Autor kurze Exkurse, unter anderem in die Ästhetische Theorie von Theodor W. Adorno.
Zuckermann entwickelt diese Gedankengänge in einer eleganten Sprache, in der Wissen und Erfahrung erkennbar werden. Seine Ausführungen sind anregend, stimulieren zum Weiterdenken. Sie überzeugen durch Tiefe und enthalten überraschende Geistesblitze. Es ist durchaus ein Genuss, diesem Gedankenfluss mit vielen originellen Deutungen zu folgen. Er wäre aber noch wirkmächtiger ausgefallen, hätte Zuckermann das Thema nicht nur in theoretisch-abstrakten Kategorien abgehandelt, sondern sich auch stärker aus der lebensweltlichen Praxis bedient. Zwar findet zum Schluss eine ideologiekritische Untersuchung der Rezeption des Todes des israelischen Sängers Arik Einstein statt, doch dieses Beispiel dient erneut dazu, mit alten Begriffen und Konzepten zu operieren, die das Denken der Frankfurter Schule geprägt haben. Ein bisschen Innovationswille wäre auch in dieser Hinsicht wünschenswert gewesen.