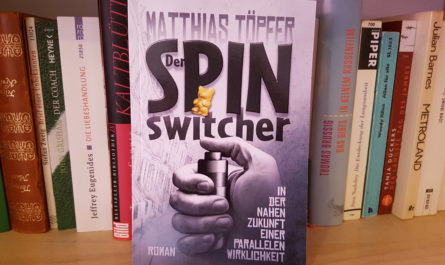Kurzgeschichte
Behutsam und mit zarten Berührungen packte Sabine ihr Cello aus. Sie schmiegte sich so gefühlvoll an, als hielte sie gerade ihren fünfjährigen Sohn in den Armen. Das Instrument war der einzige Freund im Raum, der einzige, auf den sie sich verlassen konnte. Sie spürte, wie alle um sie herum Distanz zu ihr hielten, mit einem aufgesetzten Lächeln, das frostig wirkte. „Sabine“, hörte sie die Stimme des Intendanten. „Du bist noch immer nicht geimpft, richtig?“ Sein Ton war kühler als sonst, als hätte er sie komplett abgeschrieben. Er schaute sie nicht einmal an, sondern schrieb in seinem Notizblock.
„Herbert, du kennst doch meine Meinung“, sagte sie. „Nein, noch immer nicht geimpft.“
„Das war eine rhetorische Frage, Sabine. Ich hatte nicht wirklich erwartet, dass du dich einsichtig zeigst. Ich weiß doch, wie stur du sein kannst. Wie auch immer, du musst heute mit einer Maske auf die Bühne.“
„Das ist nicht dein Ernst?“
„Das ist mein voller Ernst, Sabine! Alle anderen sind geimpft. Von ihnen geht keine Gefahr aus. Von dir schon.“
„Bitte?“ Sabine versuchte, Sätze zu bilden, verschluckte jedoch in ihrer Aufregung ein Wort nach dem anderen, als würde der Frust der letzten Jahre sie hineinsaugen. „Du verlangst von mir doch nicht, dass ich als Einzige mit einer Maske vor das Publikum trete“, gelang es ihr schließlich die Fassung zu finden. „Wie ein stigmatisiertes Vieh kurz vor der Abschlachtung.“
Herbert hob die Schultern. „Ich kann leider nichts dafür, meine Liebe. Wir haben eine Pandemie der Ungeimpften und leider noch keine Impfpflicht. Du kannst dich glücklich schätzen, dass du überhaupt spielen darfst.“ Sabine hatte das Gefühl, dass in ihren Hals bittere Magensäure hochkroch. Aber in einem hatte Herbert Recht: Sie hatte noch Glück. Wäre es ihm gelungen, kurzfristig eine andere Cellistin zu finden, würde sie heute gar nicht hier sein. Das hatte sie vorhin zufällig mitbekommen, als sich Alex und Olga unterhielten. „Er wollte sie unbedingt ersetzen, konnte aber so schnell niemanden finden“, waren die genauen Worte.
„Hast du eine dabei“, fragte Herbert und klang, als könnte er seine Schadenfreude nicht verbergen.
„Was?“
„Na eine Maske. Du brauchst eine.“
„Nein, keine dabei. Ich konnte ja nicht ahnen …“
„Dachte ich es mir doch“, fiel er ihr ins Wort. „Hier!“ Er holte aus der Innentasche seines rotbraunen Samtsakkos eine blaue Medizinmaske heraus und wedelte mit ihr, als hielte er beim Pokerspiel die Siegerkarte in der Hand. Sabine nahm sie, ohne etwas zu sagen. Sie starrte Herbert ungläubig an, nicht wirklich sicher, ob sie gerade schlecht träumte oder erneut hart mit der Realität zusammenstieß. „Bis später. Enttäusch mich nicht“, sagte er mit gespieltem Wohlwollen. Wie in Trance sah sie ihn zu Dirk, Helene und Fabian gehen, die er nacheinander strahlend umarmte. In ihren Fingern fühlte sich die Maske so künstlich glatt an, wie steril-dünner Plastikstoff. Der Gedanke, sie während des gesamten Konzerts über Gesicht und Nase tragen zu müssen, rief in ihr Ekel hervor. Ihr wurde schummrig vor Augen. Als Sabine sich umdrehte, lief sie direkt in Pamela hinein. Blitzartig hob sie beide Arme hoch, um den Aufprall abzufedern, und berührte für einen kurzen Moment Pamelas Hand. „Tut mir leid“, entschuldigte sich Sabine. „Ich bin ein bisschen durcheinander.“
„Kein Problem, nichts passiert“, sagte Pamela mit einem verzeihenden Lächeln. Ihr Gesichtsausdruck änderte sich aber schlagartig, sobald diese Worte ausgesprochen waren. In ihren Augen erkannte Sabine eine Kettenreaktion von Gedanken, die eine gewaltige Paniklawine auslösten. Pamela rannte sofort zum Waschbecken und ließ das Wasser laufen. Hektisch griff sie nach dem Desinfektionsspray und fingerte so ungelenk daran herum, dass die Flasche auf den Boden fiel. Zitternd nahm sie sich nun den Seifenspender vor, drückte ihn mehrmals und rieb sich die Hände ein, bis sie weiß schäumten. „Was ist passiert“, fragte Oliver, der als Geiger während des Konzerts direkt neben Sabine stehen würde. „Nichts“, sagte Pamela beschwichtigend, „alles gut!“ Sabine sah, dass die Situation Pamela unangenehm war, sie aber nicht anders konnte, als hätte sich ein Dämon ihrer bemächtigt. Als die Seife abgewaschen war, hob Pamela das Desinfektionsspray auf und sprühte damit ihre Hände ein, um sie dann bis zu den Unterarmen einzureiben. Wie hypnotisiert beobachtete Sabine dieses Schauspiel und sah auf Pamelas Gesicht ein kurzes Verlegenheitslächeln aufflammen, sobald sie ihre Blicke bemerkte. Dann schürzten sich ihre Lippen und verrieten konzentriertes Bemühen, jeden möglichen Erreger auf ihrer Haut zu vernichten. Sabine gelang es schließlich, sich von diesem Anblick loszureißen. Sie wendete sich wieder ihrem Cello zu, um auf andere Gedanken zu kommen. Während sie die Saiten stimmte, bemerkte sie, dass in der Dissonanz der Töne die angespannte Atmosphäre dieses Raums lag. Sabine empfand Pamelas Angst als irrational, konnte sie aber verstehen, weil sie selbst Angst hatte, wenn auch nicht vor demselben. Nicht das Virus bereitete ihr Angst, sondern die Vorstellung, künftig von Konzerten ausgeladen oder von ihrer Managerin nicht mehr vertreten zu werden. Die letzten vierzehn Monate waren hart genug. Anders als viele ihrer Kollegen sah sie in der plötzlichen Schließung des Kulturlebens nichts anderes als ein Berufsverbot. Niemand hatte gefragt, ob sie damit einverstanden war, ob sie trotz der Gefahr lieber auf der Bühne stehen wollte, ob sie finanziell durchkommen würde. Sie hätte keine Sekunde gezögert. Natürlich wäre sie weiter aufgetreten. Für sie war Musik mehr als ein Beruf; Musik war ihr Leben. Noch nie hatte sie sich so unglücklich gefühlt wie in den letzten vierzehn Monaten; sie hatte noch nie so wenig geübt. In diesem Augenblick glaubte sie, ein Trauma davongetragen zu haben. Allein der Gedanke, sie könnte Engagements verlieren und wieder Monate in Ungewissheit verbringen, ließ ihre Finger erstarren. Dieses Horrorszenario plagte sie bis zur Entkräftung. Auch jetzt wurde es wieder lebhaft. Fantasien stiegen auf, in denen sie Absagen erhielt, immer seltener spielte, bis die Musik ganz aus ihrem Leben verschwand und sie an der Kasse im Supermarkt arbeitete. Vor diesem Schicksal hatte sie noch mehr Angst als vor der Impfung. Und dennoch würde sie sich niemals impfen lassen, nicht unter diesen Bedingungen, nicht unter diesem Druck. Sie wollte selbst über ihren Körper bestimmen. Diesen neuartigen Stoff würde sie sich jedenfalls nicht in den Arm spritzen lassen; sie war doch kein Versuchskaninchen. Das musste auch Herbert verstehen. Schließlich gab es zur mRNA-Impfung keine verlässlichen Langzeitstudien. Wusste das Herbert überhaupt? Wusste er, dass es bereits jetzt sehr viele Impfschäden gab? Allein in ihrem Bekanntenkreis kannte sie fünf Personen, die an Fatigue-Syndrom, Lähmungen oder Ausschlag litten. Vielleicht sollte sie noch einmal mit ihm reden. Sabine trocknete ihre schweißnassen Hände an ihrer schwarzen Stoffhose ab und ging zu Herbert, der sich noch immer ausgelassen mit Dirk, Helene und Fabian unterhielt. Doch ein lautes Gelächter ließ sie auf halber Strecke stoppen. Galt es etwa ihr, überlegte Sabine. Sie glaubte gesehen zu haben, wie Dirk in jenem Moment verächtlich in ihre Richtung schaute. Worüber redeten sie? Was war so lustig? Ihr war gar nicht zum Lachen zumute. Ihre Glieder vibrierten, wenn sie sich vorstellte, wie sie als Einzige die Bühne mit Maske betreten würde. Sie drehte sich wieder um und wollte sich auf die Bank setzen, als sich vor ihrem inneren Auge erneut Bilder vom Arbeitsalltag im Supermarkt aufblitzten, wie energische Funken, die ihr Nervenkostüm in Brand setzten. Die innere Hitze ließ sie schnaufend wieder zu Herbert laufen, ohne dass sie sich dessen wirklich bewusst war. „Sabine? Kann ich dir irgendwie helfen?“ Sie musste eine Zeitlang stumm dagestanden und ihn angestarrt haben. „Ich, ich …“ Sie versuchte sich zu sammeln. Was wollte sie ihm eigentlich sagen, ach so, ja, richtig. „Also, ich …“
„Sabine, geht es dir gut“, fragte Herbert.
„Ja, alles in Ordnung, mir geht es gut. Ich würde dich gerne etwas fragen, Herbert, beziehungsweise, ich würde gerne mit dir reden.“
„Klar, Sabine, schieß los.“
„Unter vier Augen.“ Sie machte eine kurze Pause und schaute zu den anderen drei, die ihrem Blick auswichen. „Ginge das“, sagte sie und wusste selbst nicht, wem diese Frage galt.
„Wir sind doch eine Familie, Sabine. Und haben keine Geheimnisse voreinander. Stimmt’s“, sagte er mit breitem Grinsen, während er mit seiner Faust theatralisch gegen Fabians boxte. Dieser gab kurze Verlegenheitslaute von sich, bis eine peinliche Stille entstand.
„Ich weiß nicht recht, Herbert.“ Sie kratzte sich am Hinterkopf. „Also gut. Ich wollte mit dir über die Impfung sprechen. Weil du immer sagst, dass sie zur Herdenimmunität beiträgt. Ich verstehe deine Meinung, ich meine, ich respektiere sie. Aber du musst auch meine respektieren. Es handelt sich nicht um einen gewöhnlichen Impfstoff. Ich meine …“ Sie sah, wie Dirk, Helene und Fabian Blicke austauschten. „… es handelt sich eher um eine Gen …“
„Ich muss mich noch ein wenig vorbereiten“, sagte Dirk abrupt und drehte sich um.
„Oh ja, es fängt ja schon bald an“, verabschiedete sich auch Helene. Fabian folgte ihr wortlos.
„… eine Gentherapie“, setzte Sabine fort. „Ich meine, der neue Impfstoff manipuliert die menschliche Genetik. Und ich … Ich möchte das nicht, verstehst du? Ich will bewusst entscheiden, was ich mit meinem Körper mache, Herbert.“
„Gentherapie“, wiederholte Herbert. „Hast du das aus deinen Schwurbelmedien? Oder aus irgendwelchen Verschwörungskanälen auf Telegram? Sabine, du musst wirklich damit aufhören …“
„Das sind keine Schwurbelmedien“, unterbrach sie ihn. „Sondern Medien, die eine alternative Sicht auf die Dinge haben.“
„Alternativ heißt noch lange nicht richtig. Außerdem zwinge ich dich doch nicht, dich impfen zu lassen.“
„Doch, in gewisser Weise schon. Wenn du von mir verlangst, als Einzige mit Maske auf die Bühne zu gehen, dann ist das indirekter Impfzwang – irgendwie.“
„Sabine, also bitte! Das habe ich mir nicht ausgedacht. So ist die Vorschrift.“
„Welche Vorschrift, Herbert? Du bist doch der Intendant. Du hast hier das Sagen. Verstehst du denn nicht, dass ich mich stigmatisiert fühle?“
„Ja, ich bin der Intendant. Aber es gibt auch Leute über mir. Und die sagen, wie es zu laufen hat.“
„Aber doch nicht bei solchen Dingen“, sagte Sabine und merkte, dass sie viel schneller und hektischer redete als zu Beginn. „Über das Programm, über das Budget mögen diese Leute ja mitreden, aber doch nicht bei …“ Sie überlegte, wie sie es formulieren sollte. „Bei der Gesundheitsprävention. Das ist doch gar nicht ihre Aufgabe.“
„Sabine, glaub mir, es gibt Leute, die das bestimmen. Viel mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen. Aber gut, ich bin ja kein Unmensch. Es gibt solche hautfarbenen Masken, die man nicht erkennt. Dann setz dir eben so eine auf. Aber erst beim nächsten Mal. Heute habe ich keine hier. Am besten besorgst du dir selber eine. Du bist es schließlich, die sich zu impfen weigert. Ich muss jetzt los, Sabine. Nun zieh nicht so ein Gesicht. Bis später.“
Wie narkotisiert lief Sabine zurück zu ihrem Cello und kaute dabei auf Herberts Worten herum wie auf zähem Karamellbonbon. Hautfarbene Maske, als ob das irgendetwas ändern würde. Ihr erster Reflex war es, das Cello einzupacken und sofort zu verschwinden. Sollten sie doch zusehen, wie sie ohne sie zurechtkommen. Sie war so wichtig wie alle anderen Instrumentalisten. Ohne sie würde das Orchester zusammenbrechen. In gewisser Weise hatte auch sie Macht, konnte sie aber nicht ausspielen, und je mehr sie darüber nachdachte, desto mehr verachtete sich selbst, erst recht jetzt, als sie bemerkte, dass sie wieder begonnen hatte, das Cello zu stimmen. Jede Note hörte sich schief an. Um sie herum drängten sich ihre Kollegen, bereit, auf die Bühne zu gehen. Das Trampeln der Füße verzerrte die Töne zusätzlich, sodass es sich anfühlte, als würde sie Holz sägen. „In einer Minute“, hörte sie jemanden sagen. Sabine stand auf, blickte um sich und setzte schnell die Maske auf, in der Hoffnung, dabei nicht gesehen worden zu sein. Aber mehrere Köpfe drehten sich sofort zu ihr. Dutzende Augen waren auf sie gerichtet, verweilten kurz und verschwanden wieder wie verängstigte Häschen. In diesem Moment zog sie blitzschnell ihre Maske unter die Nase, als hätte das kollektive Wegdrehen der Köpfe diese Reaktion mechanisch ausgelöst. Dann setzte sich alle Füße in Bewegung, die Körper drängten sich aneinander. Sabine folgte dem Strom und war froh, von dieser kleinen Menschenmasse verschluckt worden zu sein. In diesem Fluss aus Köpfen fühlte sie sich für einen kurzen Augenblick geschützt, bis das laute Klatschen des Publikums immer näherkam und sie aus ihrer Geborgenheit wieder herausholte. Sie machte einen Schritt nach dem anderen, ohne zu wissen, wohin sie trieb. Was ihr so vertraut war, verwandelte sich gerade in bedrohliches Terrain. Von oben drang Lampenlicht auf sie ein. Sabine verlor sich im künstlichen Nebel, je weiter sie auf die Bühne ging. Das Gehör war jetzt die einzige Möglichkeit, herauszubekommen, was um sie herum geschah. Schauten alle auf sie? Wurde sie belächelt? Sabine hob ihre rechte Hand vor das Gesicht, um ihre Maske zu verdecken. Zumindest beim Applaus wollte sie unbemerkt bleiben. Das war der Moment, in dem die Gäste noch viel Bewegungsspielraum hatten, bevor die kontemplative Atmosphäre sie zur Regungslosigkeit zwingen würde. Als sich Sabine schließlich neben den Violinisten positionierte und in den Saal hineinblickte, tauchten schemenhaft einzelne Köpfe auf. Während sie ihre Augen nach unten zum Boden drehte, bemerkte sie, dass sie ihre rechte Hand noch immer vor ihrem Gesicht hielt. Peinlich berührt heftete sie sie an die Hüfte, hob sie dann aber automatisch hoch, sobald sie im Publikum weitere Menschenumrisse bemerkte. Ihr Herz hämmerte unerbittlich. Sabine überlegte, ob sie sich nicht hinter Peter stellen sollte, der breiter und größer war als sie. Der Klang des Klatschens flachte für einen Augenblick ab und schwang im nächsten wieder wellenartig nach oben, sodass Sabine zurückwich. Peters massiger Körper verhinderte, dass sie nach hinten fiel. Sie fühlte sich wie in einem stockdunklen Raum, in dem sie ihre Umwelt ertasten musste, um die Orientierung zu behalten. Ihre Hand griff instinktiv zur Maske, als wäre sie es, die ihr die Sicht nahm. Sie wollte das verdammte Ding schon herunterreißen, da bemerkte sie, wie im Publikum mehrere Finger kurz aufblitzen und in ihre Richtung zeigten. Dann setzte Shostakovichs Allegro ma non tanto ein. Sabine zog ihre Hand hastig runter zum Cello, verpasste aber den Einsatz. Von der Seite traf sie der strafende Blick des Dirigenten. Sie beeilte sich, um wieder im Takt zu spielen, verfehlte aber die Töne, weil sie von den vielen Augen abgelenkt wurde, die auf sie gerichtet waren. In der Symphonie hörte sie ein brummiges Tuscheln, ein verächtliches Flüstern und Geraune. Irgendwas lief schief, sagte sie sich immer wieder, irgendwas klang falsch, irgendwas war nicht richtig.
Titelfoto: Pixabay/Alexa